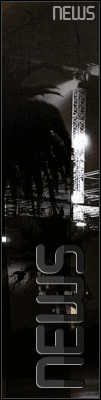 |
Werden Fensterscheiben künftig biologisch abbaubar?

Bio-Glas? Chemiker haben ein semi-transparentes Material entwickelt, das fast ausschließlich aus Holz und anderen natürlichen Substanzen besteht. Das durchsichtige Holz ist robust und leitet dank einer Verdrahtung auch Strom und könnte daher künftig beispielsweise für wärmedämmende Fensterscheiben oder Touchscreens verwendet werden. Mit einigen Optimierungen könnte es obendrein künftig biologisch abbaubar und dann eine umweltfreundliche Alternative zu den bisher verwendeten Kunststoffgläsern sein.
Kunststoffe sind billig, leicht herzustellen und zu verarbeiten und daher in unserem Alltag allgegenwärtig. „In der heutigen Zeit ist Plastik überall, auch in den Geräten, die wir mit uns herumtragen. Und es ist ein Problem, wenn wir das Ende der Lebensdauer dieser Geräte erreichen. Denn Plastik ist nicht biologisch abbaubar“, sagt Bharat Baruah von der Kennesaw State University in Georgia. Um das zu ändern, hat der Chemiker nun eine Plastikalternative entwickelt, die aus natürlichen Substanzen besteht, und auf dem Frühjahrstreffen der American Chemical Society vorgestellt.
Zusammen mit seinem Team entwickelte Baruah sogenanntes transparentes Holz. Dieser Verbundwerkstoff besteht aus ganz normalem Holz, dem zwei seiner drei faserigen Polymer-Komponenten entzogen werden, um es durchsichtig zu machen: Hemizellulose und Lignin. Übrig bleibt ein poröses, papierartiges Netzwerk aus reiner Zellulose. Dessen Poren werden dann mit einem farblosen Polymer-Material gefüllt, so dass ein semi-transparentes und zugleich stabiles Material entsteht.
Zutaten: Holz, Reis und Eier
Anders als bisherige Forscher verwendeten Baruah und seine Kollegen für die Füllung jedoch kein Epoxidharz – ein Kunststoff –, um den empfindlichen Holzfasern Festigkeit zu verleihen. Stattdessen nahmen die Chemiker historischen Zement als Vorbild, der aus Sand, Klebreis und Eiweiß hergestellt wurde. Nach dieser Rezeptur baute man in Indien bereits vor Jahrhunderten robuste Häuser, lange bevor moderne Zementmischungen erfunden wurden.
In den Schlagzeilen
künstliche Intelligenz
Künstliche Intelligenz
Diaschauen zum Thema
Holz 2.0
Biokunststoffe
Dossiers zum Thema
Alleskönner Holz - Ein Biomaterial als vielseitiger Baustoff der Zukunft
Wundermaterial Biokunststoff - Nischenprodukt oder Werkstoff der Zukunft?
Glas - Ein schwer durchschaubarer Stoff
Sonnige Aussichten mit organischen Solarzellen? - Mehr Effektivität für die flexiblen „Sonnensammler“
Smarte Kunststoffe und flexible Chips - Polytronik auf dem Vormarsch
Baruah und sein Team verwendeten in ihren Experimenten das ultraleichte und elastische Weichholz des Balsabaums und entzogen diesem in einer Vakuumkammer mithilfe verschiedener Chemikalien – darunter Natriumsulfit, Natriumhydroxid und verdünntes Bleichmittel – zunächst das Lignin und die Hemizellulose. Dann tauchten sie die verbliebene Zellulose in eine Mischung aus Eiweiß und Reisextrakt.
Damit das natürliche Polymer-Material aushärtet und dennoch durchsichtig bleibt, fügten sie zudem kleine Mengen Diethylentriamin hinzu. Diese Substanz und die verwendeten Chemikalien sind zwar im Gegensatz zu Holz, Reis und Eiern nicht natürlich nachwachsende Stoffe, in kleinen Mengen jedoch nicht umweltschädlich, wie das Team betont.
Fensterglas aus Holz isoliert Wohnräume
Das Ergebnis dieses experimentellen Prozesses waren dünne, halbtransparente „Holzscheiben“, die zugleich robust und erstmals auch flexibel waren. Aus diesem Material bauten die Forschenden testweise Fensterglas für ein Vogelhaus. Dann stellten sie dieses Vogelhaus und eine baugleiche Mini-Residenz mit normalem Glasfenster unter eine Wärmelampe.
Dabei zeigte sich, dass im Hausinneren um fünf bis sechs Grad kühlere Temperaturen herrschten, wenn es mit dem Holzmaterial „verglast“ war. Die Forschenden schließen daraus, dass der transparente Holzwerkstoff eine energiesparende, weil isolierende Alternative für Fensterglas sein könnte.
Verdrahtung im „Holzglas“ leitet Strom
Um zu testen, ob die Holzmaterialien auch für elektrische Geräte wie Smartphones verwendet werden können, baute das Team auch winzige Drähte aus Silber in einige der Proben ein. Durch diesen Zusatz wurde das transparente Holz stromleitend, wie Tests belegten. In dieser modifizierten Form könnte der Verbundwerkstoff künftig beispielsweise für Sensoren, Energiespeicher oder Beschichtungen für Solarzellen nützlich sein, berichten die Chemiker.
Die Silberdrähte sind allerdings nicht biologisch abbaubar und sollen daher in Folgeexperimenten durch andere leitfähige Materialien wie Graphen ersetzt werden. Ziel der Forschenden ist es, transparente Hölzer aus ausschließlich natürlichen und möglichst kostengünstigen Zutaten herzustellen, so dass die Materialien kompostierbar und wirtschaftlich rentabel wären.
Quelle: American Chemical Society
|