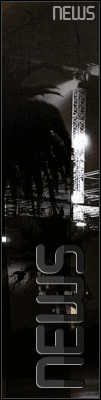 |
Studie hat elf gängige Elektroauto-Modelle im Teststand und auf der Straße getestet

Belastung oder unbedenklich? Wer im Elektroauto fährt, muss nicht befürchten, zu starken elektromagnetischen Feldern ausgesetzt zu sein. Messungen im Auftrag des Bundesamtes für Strahlenschutz zeigen, dass alle getesteten E-Fahrzeugmodelle während der Fahrt deutlich unter den empfohlenen Höchstwerten bleiben. Tatsächlich war die Belastung in einigen Autos mit Hybridantrieb und Verbrennungsmotoren sogar zeitweise höher.
Magnetfelder entstehen überall dort, wo elektrische Ströme fließen. Doch ab einer bestimmten Stärke können solche nieder- und mittelfrequenten Felder gesundheitliche Folgen haben: Sie erzeugen elektrische Ströme im Körper und können so Nerven und Muskeln reizen. Deshalb gibt es empfohlene Höchstwerte, die nach deutschen und europäischen Richtlinien nicht überschritten werden sollten.
14 Auto-Modelle im Test
Doch sieht es mit solchen magnetischen Felder in Elektroautos aus? Schon in normalen Fahrzeugen erzeugen beispielsweise Klimaanlagen, Lüfter, elektrische Fensterheber oder Sitzheizungen solche Felder. In Elektroautos kommen jedoch zusätzliche, stärkere Quellen hinzu, darunter die Akkus, die die Hochvoltverkabelung, Wechselrichter und der Elektromotor selbst.
Die Magnetfeldbelastung bei aktuellen Elektroautos hat nun ein Forschungsteam im Auftrag des Bundesamts für Strahlenschutz (BfS) untersucht. Dafür wurden Feldstärkenmessungen bei elf Elektroauto-Modellen der Baujahre 2019 bis 2021 durchgeführt, darunter Tesla Model3, Renault Zoe, BMW i3, Volkswagen ID.3 und Audi e-tron quattro. Als Vergleich dienten zwei Hybridfahrzeuge und ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Das Team testete alle Autos auf Rollenprüfständen, auf einer Test- und Versuchsstrecke sowie im realen Straßenverkehr.
In den Schlagzeilen
künstliche Intelligenz
Künstliche Intelligenz
Diaschauen zum Thema
Elektromobilität
Elektroautos
Dossiers zum Thema
Akku
Auf der Suche nach der Superbatterie - Was kommt nach dem Lithium-Ionen-Akku?
Elektromobilität - Warum ihre Stärke auch ihren Start erschwert
Elektrosmog - Handys - Gefahr am Ohr?
Mit Strom fahren - Elektroautos auf dem Vormarsch
Magnetfeld-Belastung im grünen Bereich
Die Tests ergaben: Beim Fahren bleiben alle untersuchten Elektroautos unter den Referenzwerten für erzeugte Magnetfelder. Im Mittel lagen die magnetischen Flussdichte zwischen 0,47 und 2,54 Mikrotesla. „Bei einer moderaten Fahrweise werden die Referenzwerte demnach meist im niedrigen zweistelligen Prozentbereich ausgeschöpft“, berichten die Forschenden. Auch die elektrischen Ströme, die durch diese Magnetfelder im Körper erzeugt werden, blieben bei allen Elektrofahrzeugen und Hybriden unter den empfohlenen Höchstwerten.
Das bedeutet: In reinen Elektroautos ist man nicht zwangsläufig stärkeren elektromagnetischen Feldern ausgesetzt als in Fahrzeugen mit konventionellem oder hybridem Antrieb. Im Gegenteil: „Bemerkenswert erscheint hierbei die Tatsache, dass der Maximalwert von 2,54 Mikrotesla im Fahrzeug mit Verbrennungsmotor gemessen wurde“, berichtet das Team. Zwischen der Motorleistung der Elektroautos und den Magnetfeldern in ihrem Innenraum gab es zudem keinen Zusammenhang – leistungsstärkere E-Autos sind demnach nicht belastender als schwächere.
Beruhigend zudem: Die stärksten Magnetfelder wurden nicht im empfindlichen Kopf- und Rumpfbereich gemessen, sondern an den Füßen und Unterschenkeln.
Stärkste Magnetfelder beim Start und starkem Bremsen
Allerdings gibt es kurzzeitig Situationen, in denen die Magnetfelder die Referenzwerte überschreiten können – wenn auch jeweils weniger als eine Sekunde lang. Dies trat unter anderem bei sehr sportlicher Fahrweise mit starkem Beschleunigen und Bremsen auf. Auch beim Einschalten der Fahrzeuge gab es einen kurzen Peak der Magnetfeldbelastung, wie die Messungen zeigten. Dieser Anfangspeak war jedoch unabhängig von der Antriebsart des Fahrzeugs – er war auch bei hybriden und Verbrennern messbar.
Eine Gesundheitsgefahr bedeuten jedoch auch diese kurzzeitigen Spitzen nicht: „Zwar wurden in einigen Fällen – lokal und zeitlich begrenzt – vergleichsweise starke Magnetfelder festgestellt. Die empfohlenen Höchstwerte für im Körper hervorgerufene Felder wurden in den untersuchten Szenarien aber eingehalten“, betont BfS-Präsidentin Inge Paulini. Nach aktuellem wissenschaftlichen Kenntnisstand seien daher keine gesundheitlich relevanten Wirkungen zu erwarten. „Die Studienergebnisse sind eine gute Nachricht für alle, die bereits ein Elektroauto fahren oder über einen Umstieg nachdenken“, so Paulini.
Deutliche Unterschiede zwischen den Modellen
Interessant jedoch: Es gab große Unterschiede zwischen den verschiedenen Elektroauto-Modellen. So traten beispielsweise beim Mercedes GLE 350 Hybrid eine auffällig hohe Magnetfeldbelastung im Fußbereich auf, die vermutlich durch eine ungünstig untergebrachte Verkabelung verursacht wird. Bei Tesla Model 3 und BMW i3 sind auch Passagiere auf der Rückbank im Unterleibsbereich etwas erhöhten Werten ausgesetzt.
„Die Hersteller haben es in der Hand, mit einem intelligenten Fahrzeugdesign lokale Spitzenwerte zu senken und Durchschnittswerte niedrig zu halten“, sagt Paulini. „Je besser es zum Beispiel gelingt, starke Magnetfeld-Quellen mit Abstand von den Fahrzeuginsassen zu verbauen, desto schwächer sind die Felder, denen die Insassen bei den verschiedenen Fahrzuständen ausgesetzt sind. Solche technischen Möglichkeiten sollten bei der Entwicklung von Fahrzeugen von Anfang an mitgedacht werden.“ (Bestimmung von Expositionen gegenüber elektromagnetischen Feldern der Elektromobilität; Ergebnisbericht – Teil 1)
Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz |