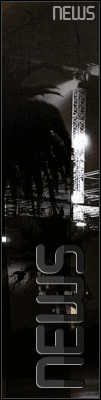 |
KI-Mediatoren können Mehrheits- und Minderheitsmeinung widerspiegeln

Ombudsmaschine: Eine künstliche Intelligenz kann besser zwischen Personen mit unterschiedlichen Ansichten vermitteln, als es menschliche Mediatoren schaffen, wie ein Experiment belegt. Die KI hilft demnach, eine gemeinsame Diskussions- und Handlungsbasis zu finden, indem sie den Meinungsaustausch klarer und unvoreingenommener zusammenfasst als menschliche Mediatoren. Dabei berücksichtigt sie auch die Perspektive der Minderheiten. Das erleichtert es den streitenden Gruppenmitgliedern, die Ergebnisse der Diskussion zu akzeptieren, wie Forschende in „Science“ berichten.
Ob politische Ansichten, Weltanschauungen oder die Entscheidungsfindung in einer Gruppe: Oft müssen wir uns mit Menschen einigen, die andere Einstellungen und Standpunkte haben als wir. Doch bei so vielen Perspektiven zu einem Kompromiss zu kommen, ist nicht einfach. Je weiter die Meinungen auseinanderliegen und je mehr Menschen an einem Diskurs beteiligt sind, desto länger und schwieriger wird der Abstimmungsprozess.
Eine Hilfe könnte hier künstliche Intelligenz (KI) sein. Denn große Sprachmodelle (LLMs) wie ChatGPT, Gemini und Co können unterschiedliche Perspektiven in einem öffentlich und online ausgetragenen Streit effektiv zusammenfassen, wie Studien belegen. Aber was nützt diese Zusammenfassung, wenn die Fronten verhärtet bleiben und man keinen Kompromiss findet? Können die KI-Systeme auch helfen, eine gemeinsame Handlungsbasis zu finden?
Wer ist der bessere Streitschlichter: Mensch oder Maschine?
Ob solche KI-generierten Zusammenfassungen den Einigungsprozess beschleunigen können, hat nun ein Team um Michael Tessler von Google DeepMind untersucht. Ihre Annahme: Menschen einigen sich schneller auf einen gemeinsamen Standpunkt oder ein gemeinsames Vorhaben, wenn sich alle Beteiligten gehört, verstanden und wahrgenommen fühlen. In einem Experiment testeten sie, ob dies besser mit menschlichen oder KI-Mediatoren gelingt.
In den Schlagzeilen
künstliche Intelligenz
Künstliche Intelligenz
Diaschauen zum Thema
HAl 9000
Wie intelligent ist künstliche Intelligenz?
Dossiers zum Thema
Künstliche Intelligenz - Wenn Maschinen zu denken beginnen...
KI-System
ChatGPT und Co - Chance oder Risiko? - Fähigkeiten, Funktionsweise und Folgen der neuen KI-Systeme
künstliche Intelligenz
Maschinenhirn mit Schwächen - Sind künstliche Intelligenzen wirklich unvoreingenommen und objektiv?
künstliche Intelligenz
Digitale Superintelligenz - Kommt die Artificial General Intelligence? Und wie gefährlich ist sie?
Neuromorphes Rechnen
Wie Maschinen das Lernen lernen - Neuromorphes Rechnen soll KI-Systeme leistungsfähiger machen
An dem Versuch nahmen 5.734 Menschen aus Großbritannien teil, die in kleinere Gruppen unterteilt wurden. Die Testpersonen sollten jeweils ihre Meinung zu verschiedenen politischen und gesellschaftsrelevanten Themen aufschreiben. Die Fragen lauteten beispielsweise: Sollte der Nationale Gesundheitsdienst privatisiert werden? Oder: Sollte der Mindestlohn angehoben werden?
Diese Ansichten präsentierten sie dann einerseits einem menschlichen Mediator und andererseits einem großen Sprachmodell (LLM), der „Habermas-Maschine“. Diese war darauf programmiert, Gemeinsamkeiten in den Eingaben zu finden. Beide Mediatoren sollten aus den Einzelmeinungen dann Gruppenstatements formulieren, gemeinsame Standpunkte hervorheben und die Mehrheitsmeinung zusammenfassen. Anschließend bewerteten die Teilnehmenden, wie sehr die beiden generierten Zusammenfassungen ihre persönliche Meinung widerspiegelten.
KI-Mediation bevorzugt
Die Auswertung ergab: 56 Prozent der Versuchsteilnehmer fanden sich eher in dem KI-generierten Gruppenstatement wieder und bevorzugten dieses. 44 Prozent stimmten dagegen eher mit der Zusammenfassung des menschlichen Mediators überein. In einem anschließenden Meinungsaustausch zeigte sich zudem: Die einzelnen Standpunkte der Gruppenteilnehmer waren nach der Mediation weniger weit voneinander entfernt als davor – und das eher, wenn ihnen diese von einer KI dargelegt wurde.
Die Forschenden wiederholten dieses Experiment in einer „virtuellen Bürgerversammlung“ mit neun Streitfragen und 200 anderen Testpersonen, die die Vielfalt in der britischen Bevölkerung noch besser widerspiegelte. Auch in diesem Test befürworteten die Personen die KI-Aussagen zu den gemeinsamen Standpunkten und waren in ihrer Gruppenmeinung anschließend weniger gespalten. „Wir stellten fest, dass die Zustimmung zu den Gruppenmeinungen ähnlich hoch war und dass die Gruppenübereinstimmung nach der Beratung ebenso deutlich zunahm“, berichtet das Team.
Was macht die KI anders als Menschen?
Nach Ansicht von Tessler und seinen Kollegen spricht dies dafür, dass künstliche Intelligenz durchaus zur Schlichtung von Konflikten beitragen und den Einigungsprozess beschleunigen kann, indem sie eine gemeinsame Diskussionsgrundlage schafft. „Diese Forschung zeigt das Potenzial der KI, gemeinsame Beratungen zu verbessern, indem sie einen gemeinsamen Nenner zwischen Diskussionsteilnehmern mit unterschiedlichen Ansichten findet“, schreibt das Team. Aber wie gelingt der KI das?
Die Forschenden vermuten, dass die Menschen die KI-generierten Aussagen besser akzeptierten und sich ihnen annäherten, weil diese sowohl die Mehrheitsposition respektierten als auch abweichende Stimmen enthielten. Die Mediatoren berücksichtigten abweichende Meinungen hingegen weniger. Zudem waren die Statements der KI klarer und fairer formuliert sowie ausführlicher und informativer, wie externe Gutachter ihnen bescheinigten.
Ersetzt KI künftig den persönlichen Meinungsaustausch?
„Die Habermas-Maschine bietet ein vielversprechendes Instrument zur Einigungsfindung und Förderung kollektiven Handelns in einer zunehmend gespaltenen Welt“, konstatiert das Team. Allerdings bedeutet dies nicht, dass man deswegen ganz auf direkte Kommunikation und menschliche Kontakte verzichten kann. Denn bei einem rein digitalen Diskurs und Entscheidungsprozess können Beteiligte auch keine persönlichen Beziehungen miteinander aufbauen.
In der jetzigen Form ist die Habermas-Maschine zudem nicht darauf programmiert, logische Fehler und Falschaussagen in den Meinungen und Argumenten der Teilnehmer zu erkennen. Sie würde daher auch selbst dann die Mehrheitsmeinung wiedergeben, wenn diese auf unvollständigen Informationen basiert oder gar nichts mit der Realität zu tun hat. (Science, 2024; doi: 10.1126/science.adq2852)
Quelle: American Association for the Advancement of Science (AAAS) |