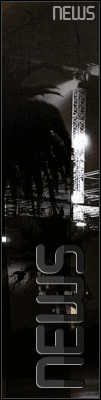 |
System aus KI-Agenten kann komplexe Simulationen planen, durchführen und darüber schreiben

Mensch bald überflüssig? In Stuttgart haben Forscher den weltweit ersten KI-Ingenieur geschaffen. Die künstliche Intelligenz besteht aus vier KI-Agenten, die gemeinsam komplexe Aufgaben aus der Strömungsmechanik erforschen und lösen können. Der KI-Ingenieur stellt Hypothesen auf, plant Versuche und liefert korrekte, reproduzierbare Ergebnisse – und kann dann darüber sogar eine wissenschaftliche Publikation schreiben. In ersten Tests löste das System Probleme zu Wasserströmungen, zur Drainage von Erdöl oder zur Aerodynamik eines Motorrads.
In der künstlichen Intelligenz geht der Trend immer mehr zu KI-Agenten: digitalen Helfern, die selbstständig auch komplexe, länger dauernde Aufgaben erledigen können. Dafür erhalten diese KI-Systeme die Fähigkeit, Informationen von Kameras, Mikrophonen oder Sensoren zu verarbeiten und auch im Internet mit Websites zu interagieren. Meist werden dafür mehrere, auf verschiedenen Fähigkeiten spezialisierte KI-Modelle miteinander verknüpft.
Ein solches Multi-Agenten-System haben nun Forscher der Universität Stuttgart genutzt, um den weltweit ersten KI-Ingenieur zu erschaffen. Dieser ist darauf spezialisiert, in einem besonders anspruchsvollen, aber für viele Anwendungen wichtigen Gebiet zu arbeiten: der Strömungsmechanik. Sie wird in Fachgebieten wie Maschinenbau und Chemie über Luftfahrt, Wasser- und Energiewirtschaft bis hin zur Meteorologie gebraucht. Gleichzeitig sind viele strömungsmechanische Probleme noch ungelöst.
System aus vier zusammenarbeitenden KI-Agenten
Deshalb haben Xu Chu und sein Team die künstliche Intelligenz OpenFOAMGPT entwickelt, die wie ein Ingenieur selbstständig Aufgaben aus diesem Fachgebiet lösen kann. Der KI-Ingenieur besteht aus vier KI-Agenten, die zusammenarbeiten und sich ergänzen: Der Vorarbeiter (Preprocessing Agent) analysiert die Anfragen des Nutzers und leitet komplexe Aufgaben an den Prompt Generate Agent weiter. Dieser zerlegt die gestellte Aufgabe in einzelne Schritte und formuliert konkrete Anweisungen, die er in einen Prompt-Pool gibt.
In den Schlagzeilen
künstliche Intelligenz
Künstliche Intelligenz
Diaschauen zum Thema
HAl 9000
Wie intelligent ist künstliche Intelligenz?
ChatGPT und Co
Deepfakes
Dossiers zum Thema
künstliche Intelligenz
Digitale Superintelligenz - Kommt die Artificial General Intelligence? Und wie gefährlich ist sie?
Killerroboter - Autonome Waffensysteme – wenn Computer über Leben und Tod entscheiden
KI-System
ChatGPT und Co - Chance oder Risiko? - Fähigkeiten, Funktionsweise und Folgen der neuen KI-Systeme
KI-generiertes Gesicht
Deepfakes im Visier - Wie kann man mit künstlicher Intelligenz erzeugte Bilder erkennen?
künstliche Intelligenz
Maschinenhirn mit Schwächen - Sind künstliche Intelligenzen wirklich unvoreingenommen und objektiv?
Der dritte KI-Agent, OpenFOAMGPT, ist der eigentlich Ausführende: Auf Basis der Simulations-Software OpenFOAM entwickelt dieser KI-Agent die für die Fragestellung passende Simulation mit den nötigen Rahmenbedingungen und startet sie. Der vierte KI-Agent dient dem Postprocessing: Er analysiert die Simulationsergebnisse, erstellt Vergleichsdiagramme und visualisiert die Resultate in Schaubildern.
Von Wasserströmung bis zur Aerodynamik eines fahrenden Motorrads
Zum Test ihres KI-Ingenieurs haben Chu und sein Team fünf unterschiedlich anspruchsvolle Fallstudien ausgewählt. In der einfachsten Aufgabe sollte die künstliche Intelligenz die Strömung einer Flüssigkeit durch einen geraden Kanal unter einem Druckgefälle beschreiben. Anspruchsvollere Aufgaben umfassten die Simulation einer mehrphasigen Strömung in porösen Medien, wie sie bei beispielsweise bei Drainagevorgängen in der Erdöltechnik vorkommt. Die schwerste Aufgabe waren turbulente Strömungen in der Aerodynamik eines Motorrads bei verschiedenen Geschwindigkeiten.
Das Entscheide dabei: Für das Ingenieurswesen ist es wichtig, dass eine künstliche Intelligenz weder halluziniert noch ungefähre, bei jedem Durchgang verschiedene Antworten liefert. Stattdessen müssen die Ergebnisse reproduzierbar sein: Bei gleichen Bedingungen muss die Simulation immer die gleichen Resultate liefern. Deshalb führten die Forscher ihre Tests bis zu hundertmal durch.
Zu 100 Prozent reproduzierbar“
Das Ergebnis: OpenFOAMGPT lieferte tatsächlich sowohl korrekte als auch reproduzierbare Ergebnisse, „Unser KI-Ingenieur arbeitet sehr gründlich und zuverlässig, eben wie ein schwäbischer Ingenieur“, sagt Chu. „Wenn ich dagegen beispielsweise ein Bild von mir in ChatGPT hochlade und zehnmal frage, ob ich gut darauf aussehe, erhalte ich zehn verschiedene Antworten. Das geht bei Ingenieursfragestellungen natürlich nicht.“
Die Tests ergaben, dass der KI-Ingenieur den Anforderungen gewachsen ist: „Unser System löst verschiedenste Fluiddynamik-Probleme erfolgreich und mit 100-prozentiger Reproduzierbarkeit“, berichtet das Forschungsteam. „Das hat uns selbst überrascht und auch ein bisschen erschreckt.“ Nach Ansicht des Teams eröffnet dies neue Chancen, komplexe physikalische Probleme auch ohne tiefgreifende Expertise in Simulationsmodellen und Formeln zu lösen – einfach durch Fragen und Aufgabenstellungen in natürlicher Sprache.
Von der Idee bis zur fertigen Veröffentlichung – alles KI
Doch das ist noch nicht alles: Der neue KI-Ingenieur kann seine Ergebnisse auch aufbereiten und daraus autonom eine wissenschaftliche Veröffentlichung erstellen. Das erste Manuskript über zweiphasige Verdrängungsprozesse in porösen Medien sei bereits fertig, so Chu. Durch zusätzlich integrierte KI-Agenten hat der Forscher das System inzwischen noch weiter ausgebaut: „Turbulence.ai“ kann auch Hintergrundrecherche betreiben, Fachbücher und Publikationen lesen, neue Forschungsideen entwickeln, Hypothesen aufstellen und sie anhand selbst geplanter Simulationen überprüfen.
Damit ist Turbulence.ai der weltweit erste KI-Wissenschaftler im Bereich der Strömungsmechanik, wie das Forschungsteam berichtet. „Da die Strömungsmechanik ein Forschungsfeld mit zahlreichen unbeantworteten Fragen ist, könnte der KI-Wissenschaftler die Wissenschaft damit unendlich bereichern“, sagt Chu. (arXiv-Preprint, 2025; doi: 10.48550/arXiv.2504.19338)
Quelle: Universität Stuttgart
|